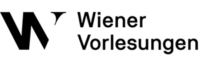Wissenschaftlerinnen fordern repräsentative Studien zu Gewalt im sozialen Nahbereich
Expert*innen
Dr.in Laura Wiesböck (Sigmund Freud Universität Wien)
Dr.in Barbara Rothmüller (Sigmund Freud Universität Wien)
Univ.-Prof.in Dr.in Birgit Sauer (Universität Wien)
Weitere Informationen zu den Expert*innen finden Sie im PDF.
Kontakt für Rückfragen
Dr. Alexander Behr
Diskurs. Das Wissenschaftsnetz
+43 650-34 38 37 8
alexander.behr@univie.ac.at
Downloads
Die Zunahme an Konflikten und Gewalt in Intimbeziehungen im Zuge der Coronakrise wurde vielfach von Expert*innen prognostiziert. Eine umfassende repräsentative Erhebung wurde dazu jedoch bisher nicht finanziert. Die Studie „Intimität, Sexualität und Solidarität in der COVID-19-Pandemie“ an der Sigmund Freud Privatuniversität liefert Hinweise auf steigende Konflikte und Gewalt im sozialen Nahbereich.
Pressemitteilung
07. Mai 2021
Die Soziologinnen Dr. Barbara Rothmüller und Dr. Laura Wiesböck fordern jährlich stattfindende repräsentative Erhebungen zu körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt von Männern an Frauen. „Die bisherige Datenlage ist unzureichend, um das
Ausmaß dieses lebensgefährlichen gesellschaftlichen Problems einschätzen zu können“, so Laura Wiesböck. Nicht nur die aktuellen Fälle an Frauenmorden verweisen auf steigende Gewalt, sondern auch bisherige wissenschaftlic hen Erkenntnisse: „Unsere Studie bietet deutliche Indizien für eine Zunahme an Konflikten in Intimbeziehungen in der Pandemie“, so Studienleiterin Barbara Rothmüller. Als Datenbasis dienen umfassende Onlinebefragungen in Österreich und Deutschland in den e rsten zwei Lockdowns mit 4706 Befragten im April 2020 und 2569 Befragten im November/Dezember 2020. Die Studie ist nicht repräsentativ, in der Stichprobe sind Frauen und Akademiker*innen überrepräsentiert und Jugendliche sowie Hochaltrige unterrepräsentiert.
Die Ergebnisse zeigen, dass im Herbst jede vierte Frau in der Umfrage eine Zunahme an Konflikten in ihrer Intimbeziehung erlebt hat. Jede dritte befragte Person, die keinen Rückzugsort im Haushalt hat, beschrieb die Stimmung im Haushalt als schlecht und häufig eskalierend. Die Hälfte der Menschen mit großen Existenzängsten erlebte auch mehr Streit im Haushalt. Diese Erkenntnisse spiegeln die Einschätzung der Co-Studienautorin Laura Wiesböck im März 2020 wider, dass ökonomischer Druck und verstärktes Zusammensein auf begrenztem Raum Risikofaktoren für ein erhöhtes Aufkommen von Konflikten und Gewalt in der Coronakrise seien. Darüber hinaus ist die Schutzsuche von betroffenen Frauen erschwert, weil sie st stärker isoliert und der Kontrolle des gewaltaus gewaltausübenden Partners ausgesetzt sind. 7% der befragten Frauen, die psychische Gewalt erlebt haben, haben keine Vertrauensperson, an die sie sich im Lockdown wenden können. Jede Dritte fühlte sich von anderen verlassen. „Zusätzlich zum Ausmaß an Gewalt ist auch die soziale Isolation der befragten gewaltbetroffenen Frauen in der Pandemie alarmierend“, so die Studienautorin Barbara Rothmüller.
Hilfestellungen von offizieller Seite wurden zum Teil verstärkt beansprucht. Bereits im März 2020 gingen bei der Frauen Helpline 50 Prozent mehr Anrufe ein, die Hälfte davon hing mit Gewalt zusammen. Auch die Zahl der Beratungsgespräche hat in dieser Zeit zugenommen. Im Forschungsprojekt der SFU, das von der Stadt Wien finanziert wurde, hat jedoch nur jede dritte befragte gewaltbetroffene Frau seit dem Frühjahr 2020 therapeutische Angebote in Anspruch genommen. Zwei Drittel der befragten gewaltbetroffenen Frauen hatten somit zum Zeitpunkt des 2. Lockdowns keine therapeutische Unterstützung.
Dass psychische Gewalt an Frauen weit verbreitet ist und sich in der Pandemie verschärft, hat Barbara Rothmüller im Dezember 2020 thematisiert. Sie beginnt bei Entwertungen, Demütigungen und Einschüchterungsversuchen und geht bis hin zu Drohungen, Erpressungen oder Stalking. Jede zehnte befragte Frau in einer Paarbeziehung hat in den zwei Wochen vor der Befragung psychische Gewalt in Form von Kontrolle, Drohungen, Beschimpfungen, o.ä. erlebt. Kurz vor oder während einer Trennung war im Herbst sogar fast jede zweite Frau betroffen. Zum Vergleich: Im 1. Lockdown erlebten nur 15% der befragten Frauen in Trennungen psychische Gewalt. Sie ist für Opfer häufig mit Gefühlen der Schuld verbunden und kann Angstzustände, Panikattacken oder Depressionen auslösen. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.
„Unsere Studie zeigt allerdings auch, dass sich Frauen aus gewalttätigen Beziehungen befreien können. Befragte, die sich über den Sommer getrennt hatten, beschrieben in den offenen Antworten ein Gefühl der Erleichterung. Und von den Befragten, die oft so wütend waren, dass sie d ie Kontrolle verloren haben, haben 40% im ersten Halbjahr der Pandemie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Die Verantwortung für aggressives und gewalttätiges Verhalten zu übernehmen, ist ein wichtiger Schritt. In diesem Prozess gibt es noch großen Bedarf an psychosozialer Unterstützung und Begleitung“, so Barbara Rothmüller.
Gewalt von Männern an Frauen im intimen Nahbereich ist allerdings ein gesellschaftliches Problem, das in patriarchalen Gesellschaften mit ihren ungleichen und hierarchischen Geschlechterverhältnissen bereits vor der Pandemie tief verwurzelt war. In Österreich ist der Gedanke, dass der (Ehe –)Mann Verfügungsgewalt über seine Partnerin hat, noch
immer stark in der Vorstellungswelt von Männern verankert. „Die Modernisierung des Eher echts in den 1970er Jahren hat zwar Partnerschaftlichkeit in der Ehe als Norm festgeschrieben, doch die Veränderungen der Arbeitswelt und Gefahren des Jobverlusts, aber auch die gestiegene ökonomische Selbstständigkeit von Frauen haben das Selbstbild vieler Männer, der Familienernährer zu sein und dadurch Macht ausüben zu können, erschüttert“, so Birgit Sauer, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Dazu kam die Mobilisierung rechtspopulistischer Akteur*innen für traditionelle hierarchische Geschlechterverhältnisse, die viele Männer darin bestärkte, befürchtete Verluste in der Arbeitswelt durch aggressive Herrschaftsansprüche gegenüber Frauen zu kompensieren. Um diese Zusammenhänge zu erforschen und entsprechende Präventivmaßnahmen zu en twickeln, braucht es grundlegende Studien.
Insgesamt zeigt sich deutlich: Konflikte, Gewaltdynamiken, wie auch psychische und emotionale Misshandlungen im sozialen Nahbereich sind sozialwissenschaftlich nicht ausreichend erforscht, obwohl bekannt ist, dass sie die Vorstufe zu lebensgefährlichen Formen der Gewalt sind. Seit 2015 sind in Österreich mehr als 200 Frauen durch ihren(Ex –)Intimpartner ermordet worden. Diese Morde fanden nicht überraschend statt, die Täter waren bereits davor gewalttätig. Um ein Bewusstsein über das Ausmaß an körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt von Männern an Frauen zu schaffen, braucht es daher jährlich stattfindende, repräsentative Datenerhebungen und nationale Jahresberichte. Denn die offiziellen Statistiken der Poli zei, Interventionsstellen, Frauenhäuser und Frauenhelplines bieten zwar einen Einblick darüber, wie viele Personen Hilfe beanspruchen (konnten), nicht aber über das tatsächliche Ausmaß an Gewaltausübung in Österreich.